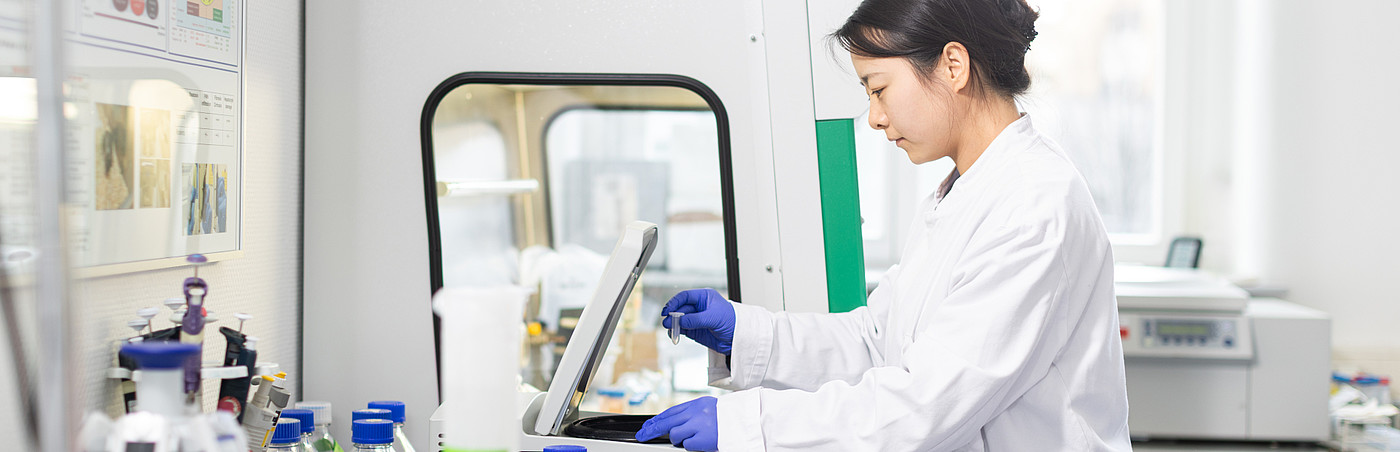Sie befinden sich hier
Inhalt
Forschungsgebiete
Das kolorektale Karzinom ist eine der häufigsten Tumorerkrankungen weltweit. Viele kolorektale Karzinome werden erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt, weshalb die Prognose trotz Einführung neuer zielgerichteter Therapien ungünstig ist. Ein Hauptproblem ist, dass das kolorektale Karzinom im Verlauf der Behandlung eine Resistenz gegenüber Chemo- und zielgerichteten Therapien entwickelt, wobei die zugrundeliegenden molekularen Mechanismen wenig verstanden sind.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es die biologischen Prozesse aufzuklären, die zu einer Therapieresistenz führen, und neue Strategien zu entwickeln, um diese Resistenz zu überwinden. Wir arbeiten dabei sehr eng mit Forschungsgruppen am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und am European Molecular Biology Laboratory (EMBL) zusammen. Wir haben dabei folgende Schwerpunkte:
1. Bedeutung des Wnt-Signalwegs für die Therapieresistenz
Der Wnt-Signalweg ist ebenso entscheidend für die embryonale Entwicklung wie für die Entstehung von Krebserkrankungen. Insbesondere sind die Bildung und der Erhalt von normalen und Krebsstammzellen im Darm vom Wnt-Signalweg abhängig. Wir interessieren uns, wie der Wnt-Signalweg die Resistenz gegenüber Chemotherapeutika und zielgerichteten Therapien beeinflussen kann. Wir konnten zeigen, dass spezifische Inhibitoren des Ras-Signalwegs den Wnt-Signalweg in Darmkrebszellen aktivieren. Dies könnte eine Ursache für die Resistenz gegenüber zielgerichteten Therapien sein. Unser Ziel ist es, die Wechselwirkungen zwischen Ras- und Wnt-Signalweg zu entschlüsseln und darauf aufbauend neue Therapieansätze zu entwickeln.
Relevante Publikationen:
Zhan T*, Ambrosi G*, Wandmacher AM*, Rauscher B, Betge J, Rindtorff N, Häussler R, Hinsenkamp I, Bamberg L, Hessling B, Müller-Decker K, Erdmann G, Burgermeister E, Ebert MP, Boutros M. MEK inhibitors activate Wnt signalling and induce stem cell plasticity in colorectal cancer. Nat Commun 2019; 10: 2197.
Zhan T*, Rindtorff N*, Boutros M. Wnt signaling in cancer. Oncogene 2017; 36: 1461–1473.
2. Systematische Identifizierung von neuen Mechanismen der Therapieresistenz
Chemotherapien, zielgerichtete Therapien und Bestrahlung bilden wesentliche Säulen bei der Behandlung des kolorektalen Karzinoms. Die molekularen Mechanismen, die zu einer Resistenz gegenüber diesen Therapien führen, sind komplex und häufig unbekannt. Um neue Ursachen für Therapieresistenzen zu identifizieren, arbeiten wir mit Forschungspartnern am DKFZ zusammen, um gepoolte CRISPR/Cas9 oder Arzneimittel-Screens durchzuführen. Ziel ist es, neue Kandidatengene zu identifizieren, deren Ausschalten die antineoplastische Wirkung verschiedener Behandlungsmodalitäten verstärken oder verringern kann. Wir verwenden aus Patienten gewonnene Organoide als wichtiges Modellsystem für die translationale Validierung dieser Kandidaten.
Relevante Publikationen:
Xiao Q*, Riedesser JE*, Mulholland T*, Li Z, Buchloh J, Albrecht P, Yang X, …, Boutros M, Ebert MP, Zhan T*, Betge J*. Combined MEK and PARP inhibition enhances radiation response in rectal cancer. Cell Rep Med. 2025; 5:102284
Bamberg, L.V., Heigwer, F., Wandmacher A.M., Singh A., Betge J., Rindtorff N., Werner J., Josten J., Skabkina O.V., Hinsenkamp I., Erdmann G., Röcken C., Ebert M.P., Burgermeister E., Zhan T.*, and Boutros M.*. Targeting euchromatic histone lysine methyltransferases sensitizes colorectal cancer to histone deacetylase inhibitors. Int. J. Cancer. 2022; 151(9):1586-1601.
Zhan, T*., V. Faehling*, B. Rauscher*, J. Betge, M.P. Ebert, and M. Boutros. Multi‐omics integration identifies a selective vulnerability of colorectal cancer subtypes to YM155. Int. J. Cancer 2021; 148: 1948-1963.
3. Der Einfluss des Darm-Mikrobioms auf die Wirksamkeit von Krebstherapien (Molecular Medicine Partnership Unit – Microbiota Drug Metabolism and Cancer Therapy)
Interindividuelle Unterschiede im Therapieansprechen und Auftreten von Nebenwirkungen sind große Herausforderungen für die Krebsmedizin. Experimente und präklinische Studien konnten zeigen, dass das Darmmikrobiom eine Vielzahl von Medikamenten verstoffwechseln. Inwiefern dieser bakterielle Arzneimittelstoffwechsel auch in Patienten stattfindet und die Krebstherapie beeinflusst, ist wenig erforscht. Im Rahmen der Molecular Medicine Partnership Unit (MMPU) arbeiten wir mit Matthias Ebert am UMM und Michael Zimmermann am EMBL zusammen, um das Potential des Darmmikrobioms für die personalisierte Onkologie zu entschlüsseln. Wir führen gemeinsame klinische Studien mit Mikrobiom-Analysen bei Krebspatienten durch, um neue Biomarker für Therapieansprechen zu identifizieren. Dazu haben wir eine große Biobank für Stuhl- und Blutproben von Patienten mit gastrointestinalen Karzinomen aufgebaut. Darüber hinaus untersuchen wir experimentell den Einfluss bakterieller Metabolite auf die Therapieantwort in Darmkrebsmodellen.
Microbiota Drug Metabolism and Cancer Therapy – Molecular Medicine Partnership Unit (embl.org)
4. Klinische und translationale Validierung der Präzisionsonkologie
Molekular zielgerichtete Therapien sind ein wichtiger Bestandteil der gastrointestinalen Onkologie. Das Spektrum dieser Therapien hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Um deren Wirksamkeit besser zu verstehen, erfassen wir klinische Verläufe von Patienten mit gastrointestinalen Tumoren, die mit zielgerichteten Therapien behandelt werden. Darüber hinaus sammeln wir systematisch Plasmaproben von diesen Patienten für molekulare Analysen, um dadurch neue Biomarker für Therapieansprechen oder -resistenz zu identifizieren.
Relevante Publikation:
Dreikhausen, L., Klupsch, A., Wiest, I., Xiao, Q., Schulte, N., Betge, J., Boch, T., Brochhausen, C., Gaiser, T., Hofheinz, R.D., Ebert, M.P., Zhan T. Clinical impact of panel gene sequencing on therapy of advanced cancers of the digestive system: a retrospective, single center study. BMC Cancer 2024; 24(1):526.
Herrmann S*, Zhan T*, Betge J*, Rauscher B*, Belle S, Gutting T, Schulte N, Jesenofsky R, Haertel N, Gaiser T, Hofheinz RD, Ebert MP, Boutros M. Detection of mutational patterns in cell free DNA (cfDNA) of colorectal cancer by custom amplicon sequencing. Mol Oncol 2019; 13: 1669–1683.
Kontextspalte
Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Tianzuo Zhan
Oberarzt
Telefon 0621/383-4642
Telefax 0621/383-3805
Weitere Mitarbeiter*innen der Arbeitsgruppe:
- Alexandra Kerner (Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin)
- Dr. med. Moying Li (ärztliche Mitarbeiterin)
- Olga Skabkina, PhD (Wissenschaftliche Mitarbeiterin)
- Nachiyappan Venkatachalam (PhD Student)
- Li Wang (medizinische Doktorandin, CSC-Stipendiatin)
- Cheri Marga Taylor (cand. med.)
- Dr. med. Lena Dreikhausen (Clinician Scientist ICON)
- Ella Eichhorn (cand. med.)
- Xinchen Yang (medizinischer Doktorand, CSC-Stipendiat)
- Xiaoxi Feng (medizinische Doktorandin, CUST-Stipendiatin)
- Rabea Kindermann (cand. med.)
- Lara Büchter (cand. med.)
- Sophia Schweitzer (cand. med.)
- Janine Runke (cand. med.)
Doktor- und Masterarbeiten
Wenn Sie an einer Master- oder Doktorarbeit interessiert sind, wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Tianzuo Zhan. Wir arbeiten mit Forschungsgruppen innerhalb des Universitätsklinikums, des DKFZ und des EMBL zusammen. Eine interinstitutionelle Promotion ist daher möglich.
Publikationen
Drittmittelförderung
- SEED (Med. Fakultät Mannheim)
- Programm "Stiftungen und Preise" der Medizinischen Fakultäten der Universität Heidelberg
- DFG Clinician Scientist Programm ICON
- SFB/CRC 1324 "Mechanisms and Functions of Wnt Signaling"
- Health + Life Science Alliance Heidelberg Mannheim
-
DKFZ-Hector Cancer Institute prime pumping grant